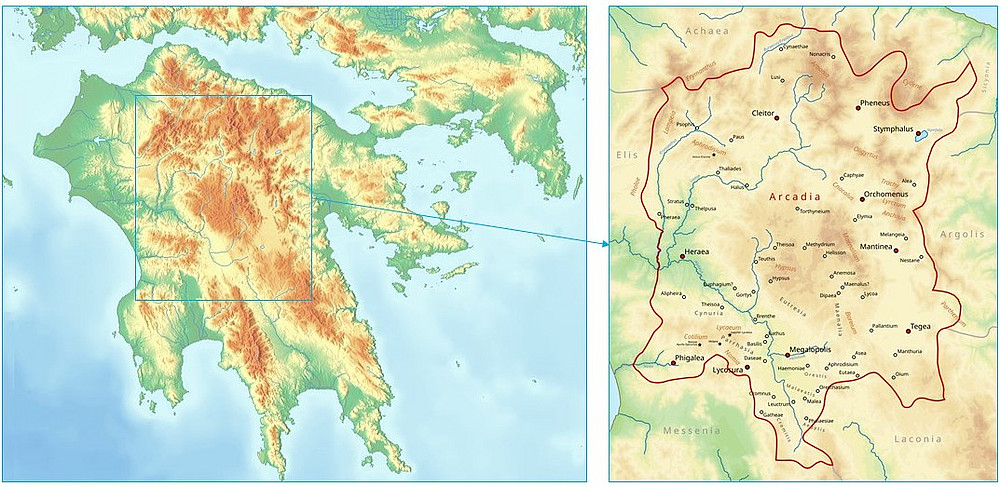Dem antiken Arkadien ist vor allem ab den 1980er-Jahren in diversen altertumskundlichen Forschungsprojekten (z. B. zu Religionsausübung und Mythen, zu Stereotypen, zur politischen Situation und zu unterschiedlichen Wahrnehmungen arkadischer Identität) sowie in archäologischer Feldarbeit große Aufmerksamkeit geschenkt worden. Die archäologische Forschung fokussierte häufig auf architektonische Monumente, darunter insbesondere Heiligtümer (z. B. am Berg Lykaion) und öffentliche Bauten (z. B. in Megalopolis). In der jüngeren Forschung hat man sich punktuell aber auch den Wohnvierteln von Siedlungen (z. B. Lousoi) gewidmet. Gebietsweise erfolgten zudem weiter gesteckte räumliche Untersuchungen in Form archäologischer Begehungen (z. B. im Tal von Asea) sowie durch die Anwendung computergestützter Methoden, wodurch ein Eindruck vom antiken Wegenetz in und um Arkadien sowie Szenarien für die Raumnutzung bestimmter Landstriche (z. B. im Tal von Lousoi) entstanden.
Die Forschung beschäftigte sich auch intensiv mit dem ab hellenistischer Zeit kolportierten Niedergang vor allem des peloponnesischen „Hinterlandes“ und dessen potentiellen Ursachen, darunter soziale Ungleichheit, politische Instabilität und klimatische Veränderungen. Dadurch konnte zwar gezeigt werden, dass viele der seit der Antike verbreiteten Vorstellungen von Entvölkerung und Verarmung der Region so explizit keinesfalls zutreffen, doch stellten die bisherigen Untersuchungen stets reale wirtschaftliche wie gesellschaftliche Hintergründe und Ereignisse in den Mittelpunkt. Eine Studie der zeitgenössischen Wahrnehmung und Interpretation von Transformationsprozessen in Arkadien bzw. deren allfälliger Konstruktion und Instrumentalisierung in und von der antiken Literatur wurde noch nicht unternommen.
Literatur – in Auswahl
P. A. Johnston – S. Papaioannou, Introduction. Idyllic landscapes in antiquity: The Golden Age, Arcadia, and the locus amoenus, ActaAntHung 53, 2013, 133–144
M. Jost, Sanctuaires et cultes d’Arcadie, EtPel 9 (Paris 1985)
M. Jost, Villages de l’Arcadie antique, Ktema 11, 1986, 145–158
J. G. Milne, The currency of Arcadia, NumChron 9, 1949, 83–92
Th. H. Nielsen – J. Roy, Defining ancient Arkadia. Symposium, April, 1–4 1998, CPCActs 6 = HfM 78 (Kopenhagen 1999)
Th. H. Nielsen, Arkadia and its poleis in the Archaic and Classical periods, Hypomnemata 140 (Göttingen 2002)
E. Østby (ed.), Papers from the third international seminar on ancient Arcadia, held at the Norwegian Institute at Athens, 7–10 May 2002, Papers from the Norwegian Institute at Athens 8 (Athen 2005)
K. Tausend (ed.), Arkadien im Altertum. Geschichte und Kultur einer antiken Gebirgslandschaft. Beiträge des internationalen Symposiums in Graz, Österreich, 11. bis 13. Februar 2016 / Ancient Arcadia. History and culture of a mountainous region. Proceedings of the international conference held at Graz, Austria, 11th to 13th February, 2016. ARGEIA 3 (Graz 2018)
B. Traeger, Arkadien. Die Münzstätten und Münzen von der archaischen bis zur hellenistischen Epoche, BBMG 12 (Bremen 2021)